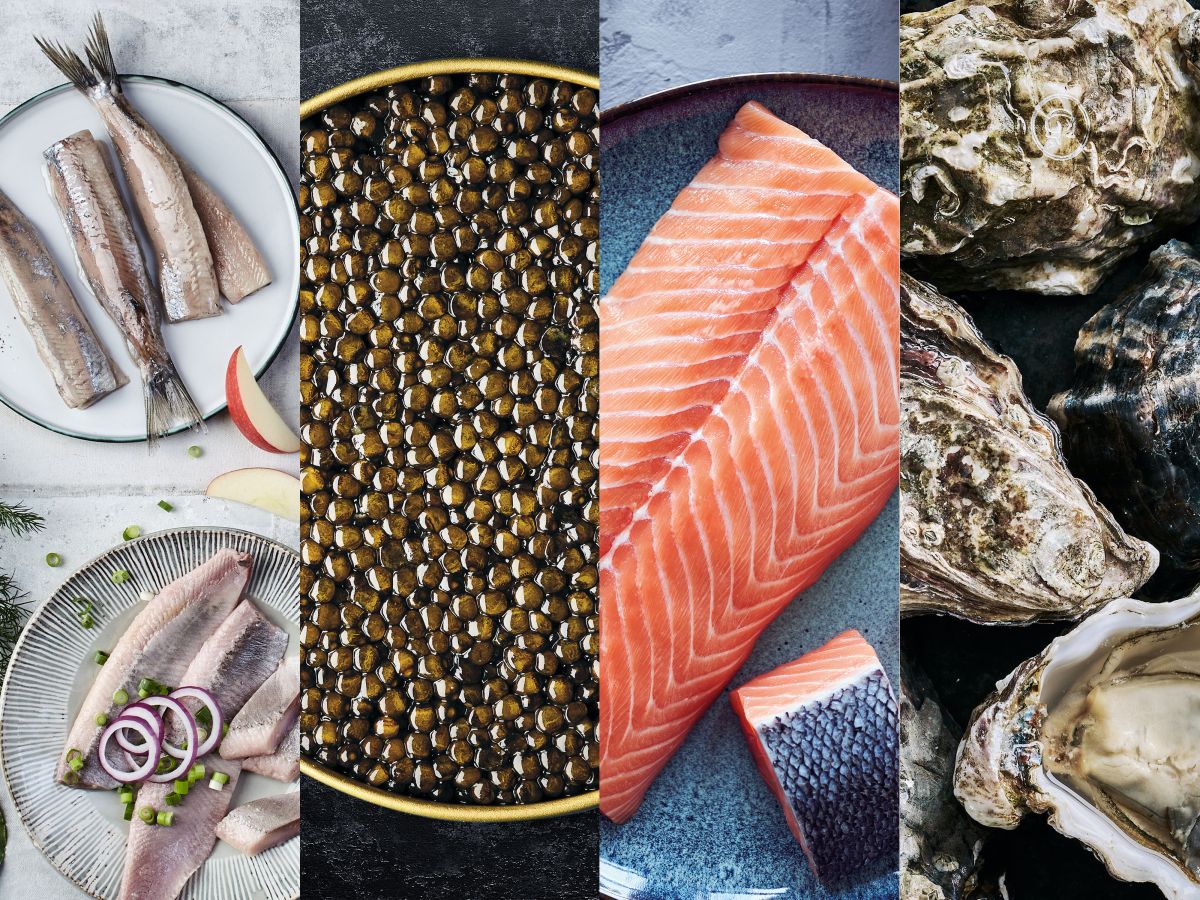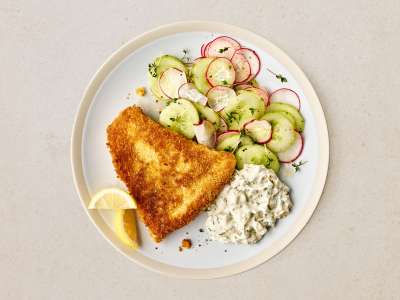Qualität durch Kompetenz
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 56 verschiedenen Nationen verkörpern die Philosophie von Deutsche See und sind unser wichtigster Erfolgsfaktor. Wir sorgen dafür, dass alle, die bei uns arbeiten, sich wohl und wertgeschätzt fühlen.
Gleiche Chancen für alle - ohne Gleichmacherei
In der Family of Fish wird jeder ungeachtet seiner Herkunft, Hautfarbe, Lebensumstände, Staatsangehörigkeit, Geschlecht, Religion, Weltanschauung, politischen Einstellung, Alters oder sexuellen Identität mit Würde und Respekt behandelt. Wir stehen für Chancengleichheit bei der Karriere. Die Auswahl, Einstellung und Förderung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgt grundsätzlich auf Basis ihrer fachlichen Qualifikation und sozialen Fähigkeit. Beruf und Privatleben sollen im Einklang bleiben – auch wenn sich etwas im Leben verändert. Deshalb unterstützen wir z.B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Kind durch flexible Arbeitszeitmodelle und ermöglichen Wiedereingliederungsmaßnahmen nach einer beruflichen Auszeit.
Verbindlich gute Konditionen
97 Prozent unserer rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind fest und sozialversicherungspflichtig angestellt und werden nach Tarifvertrag entlohnt. Bis zu 45 Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger starten bei uns jedes Jahr in neun verschiedenen Berufen und drei Dualen Studiengängen. Die Übernahmechancen nach Ende der Ausbildung sind hervorragend. Wir bieten von Anfang an Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge und eine exklusive betriebliche Gesundheitsförderung.
Hier geht’s zum kompletten Nachhaltigkeitsbericht
Sie möchten es genauer wissen? Dann geht es hier zu unserem ausführlichen Nachhaltigkeitsbericht 2023 als PDF-Download. Bei Fragen oder Anregungen schreiben Sie gern Ihr persönliches Feedback an verantwortung@deutschesee.de. Wir freuen uns über Ihre Nachricht!